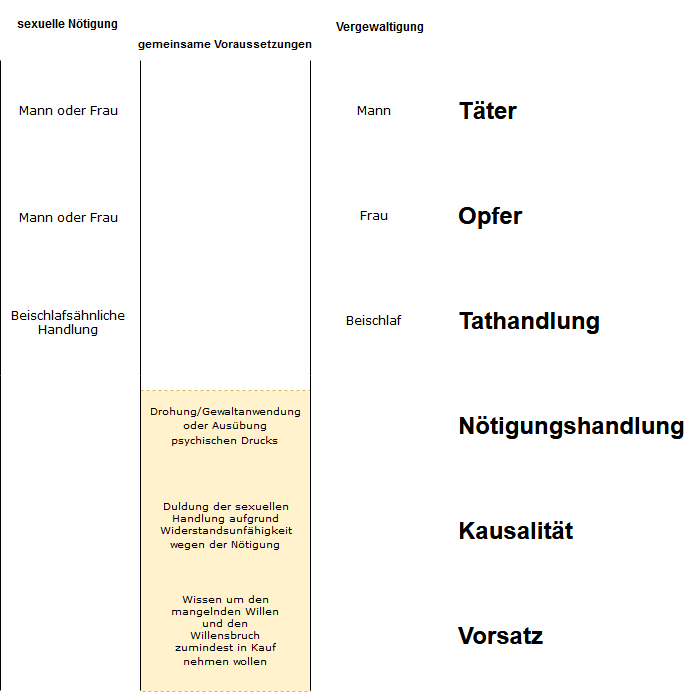Source: Staatssekretariat für Bildung,Forschung und Innovation SBFI
Im Mai entscheidet das Volk über die Volksinitiative «Für eine massvolle Zuwanderung (Begrenzungs-Initiative)». Die SVP hat es nicht leicht, die Gegner befinden sich sogar in den eigenen Reihen. Doch wie ist die Personenfreizügigkeit derzeit geregelt, welche Rechte und Pflichten werden durch das Abkommen auferlegt und was soll die Begrenzungsinitiative ändern?
Im Ergebnis ist die Begrenzungsinitiative abzulehnen: Jedem sollte es bewusst sein, dass Wohlstand und Prosperität seinen Preis hat. Die Vorteile der Abkommen überwiegen deutlich die Nachteile. Am Schluss des Artikels sind für die Kosten-Nutzen-Analyse noch verschiedene Studien und deren Ergebnisse aufgeführt.
Schlussfolgerung der Konjunktorforschungsstelle der ETH Zürich:
„Als abschliessende Einschätzung möchten wir hinzufügen, dass es nicht eines empirischen Nachweises für eine Erhöhung der Schweizer BIP-Potenzialwachstumsrate bedarf, um die Personenfreizügigkeit zu begrüssen. Die Wirtschaftstheorie zeigt, dass Migration und Arbeitsteilung gemäss komparativer Vorteile komplementär sind.“
Freizügigkeitsabkommen; Bilaterale I
Nach dem EWR-Nein im Jahre 1992 war der Bundesrat bemüht, den Schweizer Unternehmen einen diskriminierungsfreien Zugang zum wichtigsten Markt zu ermöglichen (EU-Binnenmarkt mit über 507 Mio. potenziellen Konsumenten). Die EU erklärte sich in 7 Bereichen des Wirtschaftssektors verhandlungsbereit, stellte aber die Bedingung auf, dass alle der Abkommen unterzeichnet und in Kraft treten müssten, da sie nur als Gesamtheit im Interesse der Vertragspartner wären. Dadurch entstand die sogenannte «Guillotine-Klausel», die so oft von den Politikern und Medienschaffenden erwähnt wird. Alle Abkommen, die klassische Marktöffnungsabkommen darstellen, werden unter den «Bilaterale I» zusammengefasst. Die Klausel besagt, dass die Kündigung eines Abkommens dazu führt, dass das gesamte Paket dahinfällt. So heisst es in Art. 25 Abs. 4 FZA, dass eine Nichtverlängerung eines Abkommens zur Ausserkraftsetzung aller Abkommen führt. Namentlich handelt es sich dabei um Folgende:
– Abkommen über die Freizügigkeit,
– Abkommen über den Luftverkehr,
– Abkommen über den Güter- und Personenverkehr auf Schiene und Strasse,
– Abkommen über den Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen,
– Abkommen über die gegenseitige Anerkennung von Konformitätsbewertungen,
– Abkommen über bestimmte Aspekte des öffentlichen Beschaffungswesens,
– Abkommen über die wissenschaftliche und technologische Zusammenarbeit.
Arbeitsmarktzulassung von EU/EFTA-Angehörige
Die Personenfreizügigkeit wird im Freizügigkeitsabkommen (FZA) als Bestandteil der Bilaterale I zwischen den Mitgliedern der Europäischen Gemeinschaft und der Schweiz geregelt. Dieselbe Regelungen gelten auch für Staatsangehörige der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA). Beide Abkommen traten am 1. Juni 2002 in Kraft. Durch das Abkommen werden allen Staatsangehörigen der Vertragsparteien das Recht eingeräumt, ihren Arbeitsplatz bzw. Aufenthaltsort innerhalb der Staatsgebiete der Vertragsparteien frei zu wählen. Vertragsstaaten sind (Auf die Spezialregelung für Kroatien wird nicht eingegangen):
EU-Staaten: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Republik Tschechien, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Ungarn, Vereinigtes Königreich und Zypern.
EFTA-Staaten: Island, Liechtenstein, Norwegen, Schweiz
Schlüsselprinzip des Abkommens ist die Nichtdiskriminierung gemäss Art. 2 FZA: Wer sich rechtmässig im Hoheitsgebiet eines Vertragsstaates aufhält, darf bei der Anwendung des Abkommen nicht aufgrund seiner Staatsangehörigkeit diskriminiert werden. Dem Arbeitnehmer wird gemäss Art. 2 Abs. 1 Anhang I FZA bei Aufenthalt und Erwerbstätigkeit automatisch eine Aufenthaltserlaubnis ausgestellt. Dabei werden 3 Kategorien von Bewilligungen unterschieden, die vom Dauer des Arbeitsverhältnisses abhängen:
– Keine Aufenthaltsbewilligung bei einer Dauer unter 3 Monaten (Art. 6 Abs. 2 Anhang I FZA)
– Ausweis L EG/EFTA bei einer Dauer zwischen 3 Monaten und 1 Jahr (Art. 6 Abs. 2 Anhang I FZA)
– Ausweis B EG/EFTA bei einer Dauer von über 1 Jahr (Art. 6 Abs. 1 Anhang I FZA)
Staatsangehörige der Vertragsparteien dürfen gemäss Art. 2 Abs. 1 Anhang I FZA dabei zwecks Stellensuche sich für bis zu 6 Monaten im Hoheitsgebiet der Vertragsstaaten befinden. Für Grenzgänger, die mindestens einmal wöchentlich an ihren Wohnort ausserhalb der Schweiz zurückkehren, wird eine Sonderbescheinigung nach Massgabe von Art. 7 Abs. 2 FZA ausgestellt. Zusätzlich wird im Abkommen die gegenseitige Anerkennung von Berufsqualifikationen (Art. 9 FZA) und der Familiennachzug (Art. 7 lit. d FZA) geregelt, wobei anzumerken ist, dass die Staatsbürgerschaft des Nachzuziehenden irrelevant ist.
Arbeitnehmer, die länger als 3 Monate in der Schweiz arbeiten möchten, müssen ihre Ankunft gemäss Art. 26 VEP bei der vorgesehenen Wohngemeinde melden und die notwendigen Schritte zur Erlangung des entsprechenden Aufenthaltstitels unternehmen.
Wie eingangs erwähnt, ist das Schlüsselprinzip des FZA die Nichtdiskriminierung. Der Bundesrat war bemüht, die Masseneinwanderungsinitiative abkommenskonform umzusetzen. Die Ergänzung des FZA durch den Masseneinwanderungsartikel müsste neu verhandelt werden. Die Beschränkung der Einwanderung durch Höchstzahlen hätte im schlimmsten Fall, unter Anderem wegen dem Verstoss gegen das Diskriminierungsverbot, zur Kündigung des FZA geführt. Aufgrund der «Guillotine-Klausel» wäre die nächste Folge das Dahinfallen aller Abkommen. In Anbetracht dieser Tatsache hat der Bundesrat zwecks Umsetzung der Initiative auf Verordnungsebene eine Stellenmeldepflicht für Berufsgruppen, deren Arbeitslosenquote einen bestimmten Schwellenwert erreichen (Stand 1. Januar 2020: 5%), eingeführt. Unternehmen müssen die vakante Stelle dem RAV melden und Inländern den Vorrang gewähren. Das RAV übergibt dem Arbeitgeber auf die Stelle passende Dossiers von Arbeitnehmenden (sogenannter «Inländervorrang light»). Erst nach erfolgloser Suche kann das Stelleninserat veröffentlicht werden (5 Tage Vorsprung für Inländer). Die Liste der Meldepflichtigen Berufe werden auf www.arbeit.swiss veröffentlicht.
Arbeitsmarktzulassung von drittstaat-Angehörigen
Die Zulassung von ausländischen Arbeitskräften wird für die EU-/EFTA-Angehörigen im Freizügigkeitsabkommen (siehe oben) und die von Drittstaaten im Ausländer- und Integrationsgesetz (AIG) und in der Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE) geregelt.
Zunächst muss der Arbeitgeber die Gesuchsunterlagen bei der kantonalen Arbeitsmarkt- oder Migrationsbehörde einreichen. Für Arbeitnehmende, die der Visumpflicht unterstehen, muss zusätzlich ein entsprechendes Einreisegesuch bei der zuständigen schweizerischen Auslandvertretung eingereicht werden. Die zuständige kantonale Behörde prüft, ob die Voraussetzungen des AIG erfüllt sind und überreicht den Vorentscheid dem Staatssekretariat für Migration, der eine weitere Prüfung nach gesamtschweizerischen Zulassungskriterien vornimmt. Stimmt das SEM dem Antrag ebenfalls zu, stellt das kantonale Migrationsamt eine Visumsermächtigung an die Schweizer Vertretung im Ausland aus; der Arbeitnehmer kann daraufhin das Visum abholen.
Zulassungsvoraussetzungen
Die Kriterien gemäss AIG sind in Art. 18ff. geregelt. Art. 18 sieht vor, dass eine Zulassung nur erfolgen kann, wenn «[…] insbesondere die jeweilige Arbeitsmarktsituation, die nachhaltige Wirtschaftsentwicklung und die Integrationsfähigkeit der Ausländerinnen und Ausländer [vorliegt].». Die Begründungspflicht obliegt dem Gesuchsteller (Arbeitgeber). Gemäss Art. 20 AIG werden in der VZAE Höchstzahlen festgelegt, die stets angepasst werden; ein Diskriminierungsverbot gilt nicht bei drittstaat-Angehörigen.
Des Weiteren muss der Arbeitgeber gemäss Art. 21 AIG «[…] den Nachweis […] erbringen, dass trotz umfassender Suchbemühungen keine geeigneten Arbeitskräfte mit Vorrang (Inländer) rekrutiert werden [konnten]…» Die Stellenmeldepflicht für den Inländervorrang (siehe oben) gemäss FZA gelten aufgrund Art. 21a AIG analog.
Auch müssen die persönlichen Voraussetzungen gemäss Art. 23 AIG und eine bedarfsgerechte Wohnung gemäss Art. 24 AIG vorliegen. In gewissen Fällen kann nach Art. 30 AIG von den Zulassungsvoraussetzungen abgewichen werden.
Begrenzungsinitative
Die Umsetzung der Masseneinwanderungsinitative erfolgte durch einen «Inländervorrang light». Obwohl ich persönlich selbst nichts von der Initiative halte, wurde sie angenommen und hätte pflichtgemäss umgesetzt werden sollen. Dem Volk war bei der Abstimmung bewusst, dass eine wortgetreue Umsetzung zu einer Verletzung des Abkommens und folglich wegen der «Guillotine-Klausel» zur Kündigung der Bilateralen I führen könnte. Trotzdem wurde sie angenommen, und durch diese Scheinlösung wurde meines Erachtens das Volk hintergangen. Eine Verletzung der Personenfreizügigkeit konnte durch diese Lösung minimiert werden weshalb auch die «Rasa-Initiative», die eine Streichung des Masseneinwanderungs-Artikels verlangte, zurückgezogen wurde. Das Hauptproblem, welcher Weg eingeschlagen werden sollte, wurde jedoch ignoriert.
Die Begrenzungsinitative will dieses Fiasko dadurch lösen, dass der Rechtsanspruch auf Personenfreizügigkeit endgültig beendet wird. Im Kern geht es darum, den (bereits zugestimmten) Zuwanderungsartikel umzusetzen und dadurch die Zuwanderung einzuschränken, unter Inkaufnahme einer eventuellen Kündigung der Abkommen und folglich der Bilaterale I. Sie nimmt diese Option explizit in Kauf. Unabhängig davon, für welche Seite gestimmt wird, ist die Initiative begrüssenswert: Der derzeitige «Schwebezustand» und die «Orientierungslosigkeit» ist für alle Beteiligten ein Dorn im Auge , weshalb es einer klaren Regelung braucht. Mit dieser Initiative wird das Problem der Umsetzung ein für alle Mal geklärt: Entweder wird sie angenommen, womit das Abkommen neu verhandelt (sehr unwahrscheinlich) und eventuell die Bilateralen I gekündigt wird, oder sie wird abgelehnt, womit klar ist, dass an den Abkommen nicht (mehr) gerüttelt wird.
Verschiedene Positionen
Alle Parteien, mit Ausnahme der SVP und ein paar Unentschlossenen, lehnen die Initiative ab. Auch grosse Verbände lehnen Sie aus unterschiedlichen Gründen ab. Im Grunde werden die gleichen Argumente wie bei der Masseneinwanderungsinitiative vorgebracht, weshalb nur auf die Wichtigsten eingegangen wird.
swissuniversities
Swissuniversities lehnt die Initiative ab, weil dadurch auch das Forschungsabkommen dahinfällt. Die Annahme der Initiative würde dazu führen, dass die Schweizer Hochschulen als Arbeitgeber an Attraktivität verliert und die Mobilität von Studierenden und des akademischen Personals eingeschränkt wird.
economiesuisse
Im Jahr 2018 betrug der Anteil des Aussenhandels am Schweizer Bruttoinlandprodukte 95,3%. 51,6% der aus der Schweizer exportierten Waren und Dienstleistungen gehen in EU-Staaten.

Die Personenfreizügigkeit ermöglicht den Zugang zum europäischen Binnenmarkt und wirkt dem Problem des Fachkräftemangels entgegen. Dass die Schweiz einen sehr grossen Nutzen hat durch das Abkommen, kann statistisch belegt werden. Auch ist zu erwähnen, dass die Einwanderung seit den letzten Jahren abnimmt.

Das Argumentarium der SVP überzeugt nicht. Es wird erwähnt, dass negative Auswirkungen auf die Versorgungs- und Verkehrsinfrastruktur, auf den Energieverbrauch, den Immobilienmarkt, der Umwelt, den Arbeitsmarkt und auf die Sozialwerke zu befürchten sei. Es ist jedem bewusst, dass die Zuwanderung Probleme mit sich bringt. Im Endergebnis müssen die Nachteile mit den Vorteilen abgewogen werden. Meines Erachtens ist es selbstverständlich, dass auch «Probleme» importiert werden. Zweifelsohne nehme aber ich diese Nachteile in Kauf. Auf diverse Missstände kann innerstaatlich reagiert werden, bspw. der Lohnschutz durch die «flankierenden Massnahmen». An diesen Massnahmen, die sich bewährt haben, ist festzuhalten und weiter auszubauen.
Verschiedene Studien
Wer eine fundierte Meinung bilden will, ist gezwungen, sich mit der Nutzen-Kosten-Analyse der Bilaterale I ausseinanderzusetzen. Lesenswert sind folgende Studien:
economiesuisse, Entwicklung des BIP pro Kopf, Das Wachstum der Schweiz ist besser als sein Ruf, 2016, S. 21.
„In der öffentlichen Diskussion werden hin und wieder Zweifel geäussert, ob und wie die Schweizer Bevölkerung in den letzten zehn bis 15 Jahren vom Wirtschaftswachstum profitieren konnte. Die Zahlen des BFS zeigen, dass das BIP pro Kopf in der Schweiz zwischen 2002 und 2014 real um 13 Prozent gestiegen ist. Aber man beobachtet auch, dass sich dieses Wachstum seit 2008 merklich abgeschwächt hat. Damit stellt sich die politisch brisante Frage: Sind die bilateralen Verträge für das Pro-Kopf-Einkommen der Schweizer Bevölkerung überhaupt von Bedeutung?
Für die Beantwortung dieser Frage gilt es zu berücksichtigen, dass sich die Welt erst allmählich von der grössten Wirtschaftskrise seit dem Erdölschock von 1972 erholt. Ende 2008 brachen die Märkte im Zuge der Finanzmarktkrise ein, es folgte ein massiver Rückgang des Wachstums in den entwickelten Ländern. Gerade in Europa – dem mit Abstand wichtigsten Schweizer Handelspartner – dauert diese Krise bis heute an. Die Verschuldungsproblematik ist noch nicht gelöst. Zusätzlich bewirken die umfangreichen Interventionen der Europäischen Zentralbank (EZB) eine weitere Stärkung des Schweizer Frankens. Wenn nun das nicht berauschende Wachstum des Schweizer Pro-Kopf-Einkommens während der letzten Jahre kritisch hinterfragt wird, dann müssen auch derartige Effekte in die Analyse einfliessen.
Die vorliegende Publikation verwendet ein ökonometrisches Modell, um die Entwicklung des BIP pro Kopf in der Schweiz von solchen Verzerrungen zu isolieren und die einzelnen Einflussfaktoren aufzuschlüsseln. Während der Untersuchung zeigte sich, dass die Modellergebnisse robust sind und nicht von der gewählten Modellvariante abhängen. Die Ergebnisse der Analyse lassen drei Schlüsse zu: Erstens ist das mässige Wachstum des Schweizer Pro-Kopf-Einkommens der letzten Jahre vor allem auf die schwache konjunkturelle Entwicklung in Europa zurückzuführen. Zweitens hat sich das Pro-Kopf-Wachstum der Schweiz seit dem Zeitpunkt der Einführung der bilateralen Verträge im Vergleich zu den vorhergehenden Jahren signifikant erhöht. Drittens zeigt die Analyse, dass die konjunkturelle Abhängigkeit vom Euroraum während der letzten Jahre leicht abgenommen hat. Andere Märkte – beispielsweise in Nordamerika oder Fernost – haben an Bedeutung gewonnen. Dennoch bleibt die Abhängigkeit der Schweiz von Europa gross. Um auf die eingangs gestellten Fragen zurückzukommen: Dank der bilateralen Verträge erhöhte sich das Pro-Kopf-Einkommen der Schweiz in den letzten Jahren trotz der widrigen Umstände. Oder anders ausgedrückt: Die inländische Bevölkerung wäre ohne die bilateralen Verträge signifikant weniger reich.“
Abberger/Abrahamsen/Bolli/Dibiasi/Egger/Frick/Graff/Hälg/Iselin/Sarferaz/Schläpfer/Siegenthaler/Simmons-Süer/Sturm/Tarlea, KOF Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich, Der bilaterale Weg – eine ökonomische Bestandsaufnahme, KOF Studien Nr. 58, Zürich 2015, S. 27.
„Die Schweizer Wirtschaft hat sich in den letzten zehn Jahren im internationalen Vergleich ausseror-dentlich erfreulich entwickelt. Ob und inwieweit dies mit der Einführung der Personenfreizügigkeit zusammenhängt, kann allein anhand der BIP-Entwicklung empirisch nicht eindeutig nachgewiesen werden. Allerdings kann letzteres empirisch auch nicht ausgeschlossen werden.
Einerseits ist es, bei der Vielfalt möglicher Bestimmungsgründe des Potenzialwachstumspfades, der Messunschärfe bei der Quantifizierung des BIP und der Schwierigkeit, den Output-Trend vom Zyklus zu isolieren, nicht unwahrscheinlich, dass mit den hier verwendeten Methoden auch in der Zukunft kein eindeutiger empirischer Beleg geliefert werden kann. Andererseits ist aber kaum davon auszuge-hen, dass die Personenfreizügigkeit die Potenzialwachstumsrate des Schweizer BIP vermindert haben sollte. So lag nach OECD-Daten zum Schweizer Potenzial-BIP die durchschnittliche jährliche Wachs-tumsrate im Zeitraum 2003–2013 circa einen halben Prozentpunkt höher als im Zeitraum 1991–2001, wobei der spätere Zeitpunkt die schrittweise Einführung der Personenfreizügigkeit beinhaltet. Weiter kommt eine Simulation anhand der offiziellen Schweizer Wachstumskomponentenzerlegung, unter der Annahme, dass die Personenfreizügigkeit keinen Effekt auf die totale Faktorproduktivität hatte, zum Ergebnis, dass das Freizügigkeitsabkommen die BIP-Wachstumsrate um bis zu einem viertel Pro-zentpunkt pro Jahr erhöht haben dürfte. Zum Schluss zeigt eine Regressionsanalyse, dass der Effekt noch stärker sein könnte und somit auch ein positiver Effekt der Personenfreizügigkeit auf die totale Faktorproduktivität nicht auszuschliessen ist.
Als abschliessende Einschätzung möchten wir hinzufügen, dass es nicht eines empirischen Nachwei-ses für eine Erhöhung der Schweizer BIP-Potenzialwachstumsrate bedarf, um die Personenfreizügig-keit zu begrüssen. Die Wirtschaftstheorie zeigt, dass Migration und Arbeitsteilung gemäss komparati-ver Vorteile komplementär sind.„
BAK Basel Economics AG, Die mittel- und langfristigen Auswirkungen eines Wegfalls der Bilateralen I auf die Schweizerische Volkswirtschaft, Basel 2015, S. 21f.
„Um das gesamtwirtschaftliche Schadenspotenzial eines Wegfalls der Bilateralen I zu bestimmen, wurden zwei Szenarien berechnet. Das Referenzszenario beschreibt die zukünftige Entwicklung der Schweiz unter Beibehaltung der Bilateralen I. Dem wird im Alternativszenario eine zukünftige Entwicklung der Schweiz ohne Bilaterale I ab 2018 gegenüber gestellt. Die Modellsimulationen im Alternativszenario wurden sowohl Partiell für die einzelnen Abkommen als auch im Zusammenspiel aller Abkommen durchgeführt. Im Gesamtergebnis liegt die gesamtwirtschaftliche Leistung der Schweiz im Jahr 2035 um 7.1 Prozent tiefer, als in einer Situation mit Beibehaltung der Bilateralen I.“
Ecoplan, Volkswirtschaftliche Auswirkungen eines Wegfalls der Bilateralen I, Analyse mit einem Mehrländergleichgewichtsmodell, Bern 2015, S. II.
„Die Modellrechnungen der Auswirkungen des Wegfalls der Bilateralen I zeigen:
• einen relativ grossen Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz: -4.9 BIP% bis
ins Jahr 2035. Diese BIP-Verluste liegen deutlich über den Auswirkungen anderer grosser
politischen Weichenstellungen. So wäre bspw. bei der Umsetzung eines Klima- und Energielenkungssystems im Rahmen der Energiestrategie mit deutlich geringeren BIP-Verlusten zu rechnen.
• relativ grosse Einkommensverluste in der Schweiz im Umfang von rund 1‘900 CHF/CHKopf im Jahr 2035.
• eine Schwächung der Schweizer Wirtschaft und Produktions-Standortverlagerungen – vor
allem im Vergleich zur EU. Die EU profitiert sogar vom wirtschaftlichen Bedeutungsverlust
der Schweiz. Die Bilateralen I liegen somit – aus einer rein wirtschaftlichen Betrachtungsweise – stärker im Interesse der Schweiz als in jenem der EU.
Der Wegfall der Bilateralen I führt zu einer erheblichen Schwächung der Schweizer Wirtschaft
und zu spürbaren Einkommenseinbussen bei der heimischen Bevölkerung. Es besteht ein Risiko, dass die Einbussen noch höher sind, als in dieser Studie ausgewiesen“
Staatssekretariat für Wirtschaft SECO, Bericht – Gesamtwirtschaftliche Auswirkungen eines Wegfalls der Bilateralen I, 2015, S. 33.
„Die in diesem Bericht vorgestellten Studien zeigen: Ein Wegfall der Bilateralen I ist mit deutlich negativen Auswirkungen auf die zukünftige Wirtschaftsentwicklung der Schweiz verbunden.
– Kumuliert über den Studienhorizont bis 2035 würde das Bruttoinlandsprodukt 460 bis 630 Mrd. CHF tiefer ausfallen. Damit kostet der Wegfall der Bilateralen I in weniger als 20 Jahren ungefähr ein heutiges «Jahreseinkommen» der Schweizer Volkswirtschaft.
– Bei einem Wegfall der Bilateralen I würde im Jahr 2035 das BIP rund 4.9% (Ecoplan, ohne Forschungsabkommen) bis 7.1% (BAKBASEL) tiefer liegen als im Basisszenario. Der negative Effekt auf das BIP pro Kopf würde im Jahr 2035 etwa 1.5% (Ecoplan), bzw. 3.9% (BAKBASEL) betragen.
Insgesamt reihen sich die Resultate in ihrer Grössenordnung in die bestehende Literatur zu den einzelnen Abkommen der Bilateralen I ein. Es zeigt sich insgesamt, dass die Bilateralen I als massgeschneiderter rechtlicher Rahmen für den Schweizer Zugang zum EU-Binnenmarkt von volkswirtschaftlicher Bedeutung sind.“
economieuisse, Wie die Schweiz von den Bilateralen profitiert, 2014, S. 5.
„Die Fakten machen deutlich, dass der Schweizer Wirtschaftsstandort in vielerlei Hinsicht stark von den Bilateralen I profitiert. Dabei gibt es branchenspezifische positive Effekte, aber auch solche, die sich auf alle Wirtschaftsteile erstrecken.“
Bühler/Helm/Lechner, Trade Liberalization and Growth: Plant-Level Evidence from Switzerland, Universität St. Gallen, St. Gallen 2011, S. 21f.
„This paper has proposed a policy evaluation approach towards estimating the effect of trade liberalization on growth. This approach is designed to avoid the well-known econometric difficulties plaguing previous work in this field. In particular, it allows us to identify the direction of causation from trade liberalization on growth.
Viewing a bundle of bilateral agreements between Switzerland and the EU (Bilateral Agreements I) enacted in June 2002 as a plausibly exogenous instance of trade liberalization, we have used data on the universe of Swiss plants from 1995 to 2008 to estimate the effect of trade liberalization on plant growth. Employing both a semi-parametric DiD and a matching approach, we have found the following results:
First, there is evidence for a negative anticipation effect. According to our estimates, the average growth of the affected plants was reduced by up to 2 percent in anticipation of the trade liberalization. This finding is consistent with the notion that firms improve their productivity in anticipation of a market opening.
Second, the negative anticipation effect was turned into a positive effect after liberalization, increasing the average growth of the affected plants by about 1-2 percent during the first six years after enactment. That is, the trade liberalization caused a significantand persistent extra growth of the affected plants.
Our results support the view that trade liberalization has a relevant effect on economic growth. It should be clear, though, that the effect is likely to vary across differentinstances of trade liberalization and industries affected. It would therefore be interestingto compare our results to similar policy evaluation studies of trade liberalization. Acollection of such studies is likely to provide persuasive empirical evidence on the impactof trade liberalization on economic growth.“
Egger/Larch, An assessment of the Europe agreements’ effects on bilateral trade, GDP, and welfare, European Economic Review, Volume 55, Issue 2, Pages 263-279, 2011, S. 277.
„The elimination of political trade frictions between the member countries of the European Unio nand some of the Central and Eastern European countries triggered net trade creation effects on the involved economies. The latter shows up in cumulative GDP effect estimates on the CEEC in response to the agreements of about 7%, and ones of about 0.2% in the EU15 members under reasonable assumptions about the elasticity of substitution across produced varieties.“
Brunetti/Bucher, Die Bilateralen I aus wirtschaftlicher Sicht, Die Volkswirtschaft 11-2008, S. 6.
„Deshalb kann man davon ausgehen, dass bei Fortbestehen des bilateralen Weges in einigen Jahren die selben Analysen erneut durchgeführt werden. Auch dann wird die exakte Messung der Wirkungen eine schwierige Aufgabe bleiben, da unabhängig von der vertraglichen Öffnung viele weitere Faktoren auf die wirtschaftliche Entwicklung in den von den Abkommen abgedeckten Sektoren einwirken. Unbestritten bleibt aber die erwartete Richtung der wirtschaftlichen Effekte: Die Wirkung des Abbaus von Grenzen und des Austauschs von Wissen ist positiv und kraftvoll. Mit den bilateralen Abkommen werden Rahmenbedingungen geschaffen, welche den Standort Schweiz stärken und für die Schweizer Firmen in wichtigen Bereichen bessere Wettbewerbsbedingungen schaffen. Diese stabilen und bewährten Rahmenbedingungen sind heute in Zeiten einer unsicheren Wirtschaftsentwicklung wichtiger denn je.“